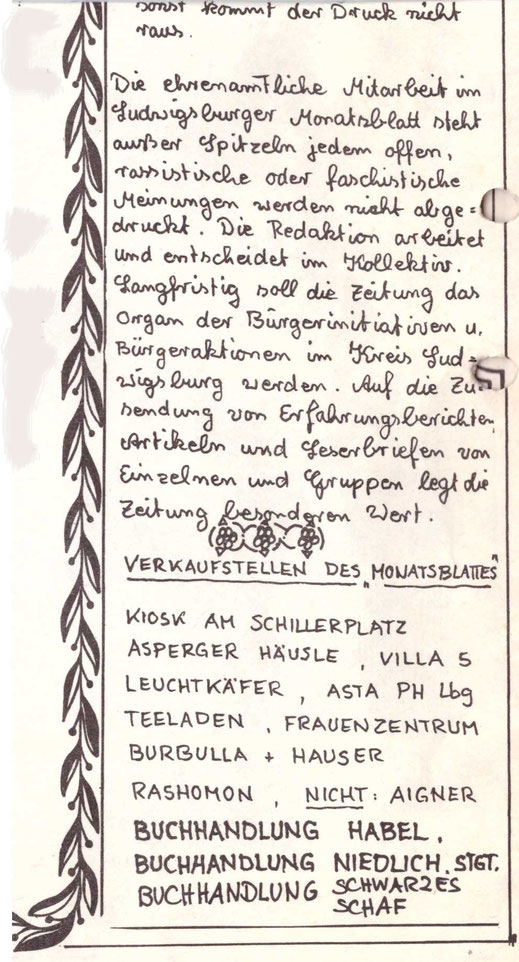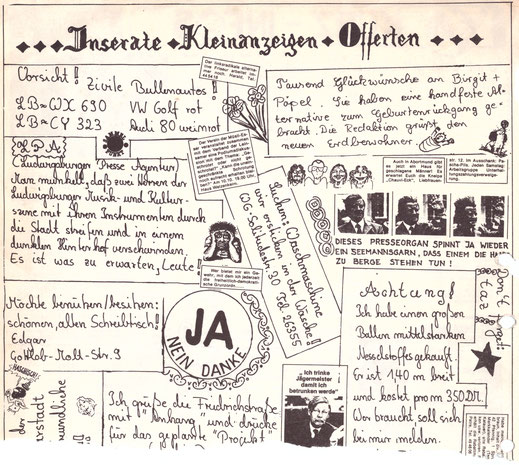Wer, außer mir, soll wissen, was gut fuer mich ist?
Der Geschmack von Freiheit und Provokation
Am 7. Juni 1973 wurde ich 18. Zum Geburtstag schenkte ich mir einen spektakulären Auftritt, der bei meinen Schulkameraden Bewunderung, beim Schulleiter des Mörikegymnasiums ungläubiges Staunen und bei meinen Eltern Sorgen und Wut hervorrief. „Ich kündige, das hier ist nichts für mich“, erklärte ich dem Schulleiter und machte damit von meinem Recht auf Selbstbestimmung Gebrauch. Ich hatte zwar keinen Plan, was ich machen wollte, ich wusste nur, was ich keinen Tag länger wollte: Frontalunterricht, meist von alten Knackern, der mich abturnte. Einen Funken Interesse hatte ich in Deutsch, Geschichte und Biologie. Einen größeren hätte ich in Musik haben können, wenn wir nicht von „Wahnsinns Walter“ geknechtet worden wären. Er forderte uns auf, die Musik, die uns gefiel, in den Unterricht mitzubringen. Ich brachte „The Black Man’s Burdon“ von Eric Burdon mit, darauf die superschönen Fassungen von „Paint it Black“ und “Nights in White Satin“. Noch während die Musik lief, machte sie „Wahnsinns Walter“ herunter: „Negermusik. Was für ein Geschrei!“ Ich war von der Musik so überzeugt, dass mich dieser unqualifizierte Verriss noch nicht einmal kränkte. Aber er war der letzte Anstoß, aufs Rektorat zu gehen und mich von der Schule abzumelden: So nicht Leute, leckt mich am Arsch. Das kann nicht mein Weg sein. In diese Welt will ich nicht gehören. Ich kündige!
Das war in der elften Klasse. Schon in der neunten kiffte mehr als die Hälfte der Klasse und mehr als die Hälfte der Klasse fiel dann auch durch. Ich war natürlich dabei. Wir waren schlau, wir provozierten. Wir kamen nicht aus Akademikerkreisen, sondern aus sogenannten kleinbürgerlichen Verhältnissen. Aber das war uns egal. Ein Viertel der Klasse flog von der Schule, das andere Viertel wurde auf andere Klassen verteilt. Eines Tages lag in einer Ecke des Zeichensaals, in dem der Schülerrat tagte, ein Scheißhaufen. Wir ließen ihn da, wo er war. Damit war keine politische Botschaft verbunden, die Botschaft war die Provokation. Wir fanden die Provokation berechtigt. Sie war eine Form, wie wir uns gegen die autoritären alten Knacker wehren konnten.
Aus heutiger Sicht finde ich unmöglich, wie wir uns gegenüber den Lehrern benommen haben, vor allem gegenüber den Referendaren. Wir haben ausprobiert, was wir machen mussten, bis ein Referendar Strafarbeiten verteilte, schrie oder zum Direktor ging. Ich hatte den Eindruck, die Referendare wurden wie im alten Rom in den Löwenkäfig gesperrt und dort mussten sie um ihr Leben kämpfen. Meine Tochter Ruby ist Lehrerin geworden. Ich hoffe, dass sie nie Schüler bekommt, wie wir einmal waren.
Ich war im Schülerrat und in der marxistisch-leninistischen Schülergruppe, nicht weil ich politisch gewesen wäre, sondern weil man während der Kapitalschulung zu Mädchen aus dem „Goethekloster“ hinüber linsen konnte. Dass die Welt ungerecht war, wusste ich schon vorher. Es gab kluge Köpfe wie Marx und Lenin, die alles durchschauten. Aber Theorien interessierten mich nicht übermäßig, Mädchen schon mehr, aber das auch erst seit der Pubertät. Ich wuchs mit zwei älteren Brüdern auf, besuchte ein Jungen-Gymnasium und verbrachte meine Freizeit mit Typen. Obwohl ich in dieser männlich geprägten Welt aufwuchs, war körperliche Gewalt nie meine Sache. Ich wollte nicht, dass mir wehgetan wird und wollte auch nicht anderen wehtun. Mädchen traten erst spät in mein Leben.
Steppenwolf und Pink Floyd
Nach meiner Kündigung wurde es zu Hause ungemütlich. Meine Eltern waren hilflos, weil ich nichts machte. Tagsüber hing ich rum, abends und nachts war ich in Discos und auf Partys. Mit meinen Kumpels redete ich
Nächte lang über Hesses „Steppenwolf“ oder „Demian“. Wir analysierten oder interpretierten diese Romane nicht, sondern assoziierten frei. „Was würdest du in diesem Fall machen?“ war eine beliebte Frage. Ja, dann entwickelte jeder seine Vorstellungen und die Anderen hörten interessiert zu, stimmten zu oder entwickelten ihre eigenen Vorstellungen. Unsere Gespräche wurde von unseren Lieblingsplatten begleitet, von King Crimson, Pink Floyd und natürlich Emerson, Lake and Palmer. Ansonsten machten wir es zu unserem Sport, in die immer häufiger stattfindenden Rock- und Popkonzerte der Stadthalle zu gehen, ohne zu bezahlen. Eine von vielen Taktiken war folgende: 200 Leute drückten so brutal gegen die Kette der Ordner am Eingang, dass die Ordner nicht mehr standhalten konnten. Diese Lücken nutzten wir und stürmten in den Saal. Wir glaubten, die Musiker seien die Guten, die ja nur Musik machen wollten und sich gar nicht um Geld scherten. Die Bösen waren die Veranstalter, denen es nur um Geld ging. Am meisten bekämpften wir Mama Records. Sie waren für uns die Verkörperung des Kapitalisten. Auf die Idee, dass die Veranstalter auch an guter Musik interessiert waren und zwar an derselben wie wir, kamen wir nicht so recht.
Die Bärenwiese
Im Juni war ich also volljährig geworden. Wenn es mir zu Hause zu blöd wurde, ging ich ins Freie oder zu Freunden. Essen und Trinken gab es immer irgendwo. Die meiste Zeit verbrachten wir auf der Bärenwiese. Die war der Treffpunkt der Jugendlichen und auch der Hauptumschlagplatz für Drogen aller Art. Wir dealten etwas mit Haschisch und LSD. Unsere Hauptabnehmer waren die amerikanischen GIs. Wir, meine Freunde und ich, entwickelten schon damals ein gewisses „Qualitätsbewusstsein“. Wir hatten den besten Stoff, weil wir saubere und zuverlässige Quellen hatten. Wir gingen mit dem Stoff bewusst und kontrolliert um, wir kannten uns ja mit der Dosierung aus und mit Nebenwirkungen, wenn der Stoff gestreckt oder verunreinigt war. Dies unterschied uns von anderen Gelegenheitsdealern, die oft den letzten Dreck viel zu teuer verkauften und sich nicht selten auch noch in anderen kriminellen Milieus bewegten. Allerdings hatten wir keine Kontrolle über die Konsumenten, wir wussten nicht, wie sie mit dem Stoff umgingen. Diese Tatsache beunruhigte mich dann zunehmend und drückte auf mein Gewissen. Als mir klar wurde, wie eng der Zusammenhang zwischen Drogen, organisierter Kriminalität und dem Terrorismus der PLO war, gab ich das Konsumieren und Dealen auf. Ich wollte nicht am Tod anderer verdienen.
Meine erste Kommune und die zweite Kündigung
Im Winter 1974/75 zog ich mit einer Menge Leute nach Affalterbach. Wir waren insgesamt 14 und davon arbeitete nur einer regelmäßig. Er hatte auch den Mietvertrag unterschrieben. Wir hatten kaum einen Plan für irgendetwas, jeder machte, was er wollte. Wenn wir kein Geld mehr hatten, um uns etwas zu essen oder eine neue Gitarrensaite zu kaufen, fuhren wir mit einem alten VW-Bus nach Ludwigsburg zum Arbeitsamt. Dort gab es einen Raum, in dem
die Tagelöhner saßen. Ab und zu kam ein Typ rein, schaute sich um, zeigte auf ein paar von uns und sagte: Ihr könnt mitkommen. Meistens gab es Arbeit auf dem Bau oder bei Reinigungsfirmen.
Günter, der den Mietvertrag abgeschlossen hatte, hatte eines Tages die Faxen dicke und kündigte. Wieder hatten wir keinen Plan, wie es weitergehen sollte. Da die meisten nicht wussten, was sie mit ihren Möbeln machen sollten, machten sie im Garten ein Feuer und verbrannten alles. Ich rettete meine Schallplattensammlung, den Plattenspieler und meine Gitarre, indem ich mich auf sie setzte. Sonst wären sie möglicherweise auch im großen Feuer gelandet.
Anthroposophie und Makrobiotik
Noch als wir in Affalterbach wohnten und es genossen, ein freies Leben ohne Einschränkungen und Pflichten zu führen, entwickelten ein Schulfreund und ich die Idee, gesunde Lebensmittel zu erzeugen und zu vertreiben. Konsequenterweise suchten wir einen Platz, wo wir diese Idee verwirklichen konnten. Irgendwie erfuhren wir von einer anthroposophischen Enklave im hohenloheschen Weckelweiler. Dort gab es eine Demeter-Bauernschule, für die wir uns interessierten, irgendwie halt. Wir wussten nicht so richtig, was wir von der Bauernschule wollten, noch wussten die Betreiber der Bauernschule, was sie mit uns anfangen sollten. Wir bekamen einen Schlafplatz auf dem Dachboden. Essen konnten wir in der zentralen Küche. Manchmal versorgten wir uns auch selbst. Wir verbanden den Demeter-Anbau mit Makrobiotik. Das war für die Anthroposophen neu und irgendwie interessant. Manchmal beteiligten wir uns an den Arbeitseinsätzen bei Bauern, aber eben nur, wenn wir Lust hatten und morgens rechtzeitig aufwachten. Wir wollten alles selber machen und uns natürlich auch nicht von den Anthroposophen drein reden lassen. Ich nähte mir zum Beispiel ein Hemd aus Stoffresten, weil ich der Meinung war, das kann ich doch selbst. Was soll ich mir eins kaufen? Abgesehen davon, dass ich dazu kein Geld gehabt hätte. Mir gefiel es, mir selbst etwas zu erarbeiten. Das ist noch heute so. Ich glaube, ich bin der geborene Autodidakt.
Auch die Zeit bei den Anthroposophen war begrenzt. Das wussten wir und das wussten sie. Mich wundert noch heute, wie tolerant sie gegenüber unseren rasanten Wechseln zwischen überzogenem Aktivismus voller Utopie und plan- und ziellosem Rumhängen waren.
Landkommune
Mein alter Freund Thomas fand ein Haus in der Nähe von Dinkelsbühl. „Haus“ ist etwas übertrieben, es war eher eine Hütte mit zwei Zimmern, eins unten, eins oben. In der Küche gab es eine Wasserpumpe und einen Holzofen. Jetzt machte uns das Leben richtig Spaß – wir konnten alles selber machen. Wir mussten es auch, denn es gab keine Einrichtung. Wir konnten unserer Tatkraft und Kreativität freien Lauf lassen, indem wir lernten, Möbel zu bauen. Der Winter war kalt und hart, für uns gerade die richtige Herausforderung. Also auch im „Survival-Training“ waren wir wieder ganz vorn dabei.
Als es Sommer wurde und wärmer, waren alle unsere Freunde und Freundinnen da, um das freie Leben und die Natur zu genießen. Etwa zwölf Leute kamen und gingen, wie es ihnen Spaß machte. Wir machten Sessions, gerne nachts bei Kerzenschein und beschallten das ganze Dorf. Thomas und ich wurden im Lauf des Sommers restriktiver. Wir nahmen Rücksicht auf unsere Nachbarn, mit denen wir schließlich zusammenleben mussten. Dazu gehörte z.B., dass die Besucher nicht mehr in Sichtweite der Nachbarn nackig um das Haus springen oder ähnliche provokative Scherze treiben durften.
Dramen wurden stets frei Haus geliefert, wir konnten ihnen nicht entgehen. Einmal trommelten Eltern eines Mädchens nachts mit den Fäusten gegen die Tür, um ihre Tochter, die sich mit einem Freund abgeseilt hatte, nach Hause zu holen. Sie weckten nicht nur uns auf, sondern das ganze Dorf. Auch tauchte ab und zu die Polizei auf, um ausgebüxte Minderjährige zurück zu ihren Eltern zu bringen.
Die Welt durch gesunde Lebensmittel verändern
Wir hatten keinen Druck, wir lebten von Tag zu Tag. Ganz im Hier und Jetzt. Wenn wir Geld brauchten, arbeiteten wir als Hilfsarbeiter. Thomas fing an, aus Ästen und Blüten Anhänger zu basteln und sie auf Flohmärkten zu verkaufen. Ich sammelte und trocknete Kräuter, die ich in Naturkostläden in Tübingen und Stuttgart verkaufte. Zwar lebten wir noch immer ziemlich plan- und ziellos, aber langsam bildeten sich Neigungen und Ideen heraus. In mir konkretisierte sich die Idee, die Welt durch gesunde Lebensmittel zu verändern. Meine Strategie bestand schon damals darin, etwas Hochwertiges und Gesundes zu entdecken, das andere nicht hatten und es dann zu verkaufen. Daraus ergab sich konsequenterweise, einen Naturkostladen zu gründen.
Nachdem wir einen Winter und einen Sommer in Gelshofen unsere Visionen entwickelt hatten, trennten sich unsere Wege. Thomas entdeckte seine Leidenschaft für die Gestaltung von Holz. Diesen Weg wollte er weiterverfolgen. Und er tat dies auch leidenschaftlich und konsequent. Er zog nach Gemmingen auf die halb verfallene Burg Streichenberg und vertiefte sich in die Holzgestaltung. Seit mehr als 25 Jahren betreibt er mit einigen Mitarbeitern die Holzmanufaktur Urholz.
Selbstversorger Landkommune auf der Schwäbischen Alb
1976 zog ich zu Jürgen Rösner auf die Alb, der sich in Hermentingen bei Sigmaringen eingemietet hatte. Ich wollte eine Landkommune gründen, die sich selbst versorgen konnte. Wir begannen mit Sojabohnen. Im Übrigen probierten wir alles Mögliche aus. Manches klappte, manches ging schief. Das selbst auferlegte Kreuz eines katholisch Erzogenen: Ich akzeptiere keine Belehrung. Alles, was ich je gelernt habe, habe ich aufgeschnappt oder ausprobiert. Ich war immer der Überzeugung: Ich kann das auch. Wer eigentlich außer mir soll wissen, was gut für mich ist?
Der Leuchtkäfer – die Anfänge
„Etwas Gutes haben, was die Anderen nicht haben“ war mein Grundsatz und meine Geschäftsidee. Im Mittelpunkt meines Denkens und Handelns stand nicht, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften, sondern meine Identifikation mit den Produkten. Ich wollte mit Lebensmitteln handeln, die diesen Namen auch verdienten.
In Ludwigsburg fand ich 1977 in der Max-Eyth-Straße einen kleinen Laden, der vor allem Gebrauchtwaren verkaufte. Peter räumte mir eine Ecke ein, in der ich das erste selbst gemischte Müsli und selbst gebackenes Brot verkaufte. Das war der Beginn des Naturkostladens Leuchtkäfer, dem ersten Naturkostladen in Ludwigsburg, sogar dem ersten im Kreis Ludwigsburg.
Fortsetzung folgt
Denn ab jetzt geht die Geschichte erst richtig los. Bitte haben Sie etwas Geduld, ich bin sehr beschäftigt. Mir wurde erst Mitte 40 klar, dass ich keinerlei Rentenansprüche habe. Meine Arbeitsfähigkeit muss ich noch recht lange erhalten und am besten tue ich dies, indem ich weiterhin mit Freude und Liebe gute und gesunde Lebensmittel verkaufe.
Vorab ein Einblick in eine Demonstration in Ludwigsburg im Februar 2011.

Erzählt von Eberhard „Pöpel“ Simon. Bearbeitet von Regina Boger 2017